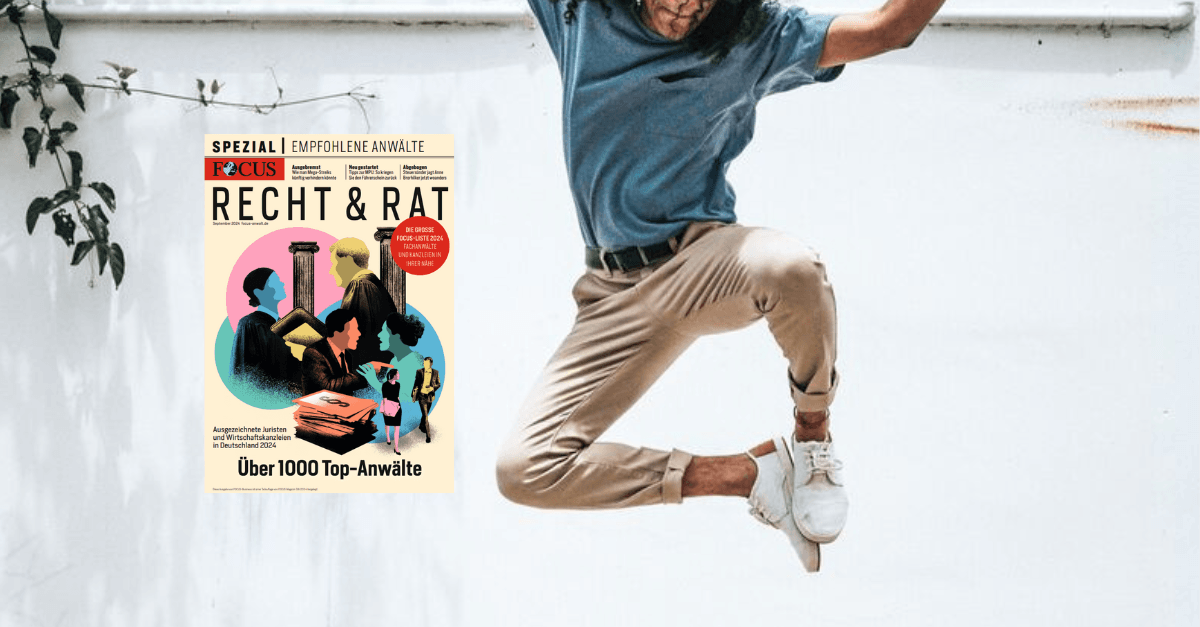Wenn Lieferanten in Schwierigkeiten geraten, ihre Vertragspflichten zu erfüllen, ist oft von höherer Gewalt („Force Majeure“) die Rede. Als rechtlicher Aufhänger für eine Entlastung des in Lieferschwierigkeiten geratenen Verkäufers, wird die höhere Gewalt etwa jüngst im Kontext und in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine thematisiert; aber auch im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und mit den multikausal verursachten Lieferengpässen für viele Produkte in den letzten Monaten wird immer wieder auf sie abgestellt. Ist die höhere Gewalt also das Rechtsinstitut der Stunde?
Im deutschen Kaufrecht ist der Begriff der höheren Gewalt gar nicht geregelt. Vielfach enthalten allerdings Lieferverträge bzw. Allgemeine Verkaufsbedingungen Regelungen zu diesem Themenkomplex. Im insbesondere durch das AGB-Recht gesteckten Rahmen der rechtlichen Zulässigkeit ist eine Antwort auf die gestellte Frage daher vorrangig in solchen vertraglichen Regelungen zu suchen. Die Internationale Handelskammer (ICC) hat 2020 Musterklauseln veröffentlicht, die oft eine taugliche Vorlage für eigene Verträge sein können (s. unseren Beitrag: https://www.skwschwarz.de/details/neue-icc-musterklauseln-ueber-hoehere-gewalt-und-unvorhergesehene-leistungserschwernisse).
Enthält der Vertrag keine spezifische Regelung hierzu, kommt es für die Frage, ob sich der Lieferant bei durch unvorhergesehene Umstände verursachten Lieferschwierigkeiten entlasten kann, nach deutschem Recht nicht darauf an, ob sich die Ursache als höhere Gewalt verstehen lässt. Maßgeblich ist vielmehr die Frage, ob Unmöglichkeit vorliegt. Ist es dem Lieferanten unmöglich, den Vertrag zu erfüllen, so wird er von seiner Leistungspflicht frei. Hierfür genügt es aber noch nicht, wenn über die eigentlich geplante eigene Lieferquelle ein Produkt nicht erhältlich ist. Sofern nicht eine Lieferung aus einer bestimmten Produktion vereinbart wurde, ist von Unmöglichkeit erst dann auszugehen, wenn auch eine Beschaffung aus anderen Lieferquellen nicht möglich ist. Den Lieferanten trifft nämlich grundsätzlich eine Beschaffungspflicht, die ihm gegebenenfalls auferlegt, auf andere Quellen auszuweichen. Dies gilt in gewissen Grenzen (zu diesen s. u.) auch dann, wenn dies für ihn mit einem deutlich höheren Einkaufspreis verbunden ist. Diesen wirtschaftlichen Nachteil kann er nicht an den Kunden weitergeben. Ist dagegen auch anderweitig kein Bezug möglich, wird der Lieferant aufgrund dann anzunehmender Unmöglichkeit von seiner Lieferpflicht frei (§ 275 BGB). Gleichermaßen wird auch der Kunde von seiner Pflicht befreit, den Kaufpreis zu bezahlen (§ 326 BGB). Hat der Käufer den Kaufpreis vorab gezahlt, ist dieser zu erstatten (§ 346 BGB). Liegt Unmöglichkeit vor, so muss der Lieferant auch keinen Schadensersatz leisten, wenn er beweisen kann, dass er die Unmöglichkeit nicht verschuldet oder aus anderen Rechtsgründen zu vertreten hat.
Unterhalb der Schwelle der Unmöglichkeit kommt ggf. ein Anspruch des Lieferanten auf Vertragsanpassung wegen Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) in Betracht. Das kann etwa der Fall sein, wenn eine Durchführung des Vertrags zwar nicht unmöglich ist, aber Aufwand und Kosten dermaßen außer Verhältnis geraten sind, dass dem Lieferanten die Durchführung des Vertrages mit dem ursprünglichen Inhalt nicht mehr zumutbar ist. Das ist allerdings eine hohe Hürde. In einer solchen Konstellation kommt z.B. eine Beteiligung des Käufers an den gesteigerten Kosten in Betracht, wenn er auf einer Durchführung besteht.
Bei grenzüberschreitenden Verträgen ist es aber nicht selbstverständlich, dass deutsches Recht anzuwenden ist. Was gilt dann?
Entscheidend ist zunächst, festzustellen, welche Rechtsordnung anwendbar ist. Zumeist, aber keineswegs immer, enthalten internationale Lieferverträge eine entsprechende Regelung. Ist im Vertrag die Anwendung deutschen Rechts vereinbart, gilt das, was wir in dem oben bezeichneten Beitrag ausgeführt haben. Aber Achtung: Es kommt auf die Details der Formulierung an. Lautet etwa eine Rechtswahlklausel: „Es gilt deutsches Recht“, kommt nicht das deutsche Kaufrecht, wie es in BGB und HGB geregelt ist, zum Zug. Stattdessen ist dann das UN-Kaufrecht (CISG) anzuwenden, da dieses Teil des deutschen Rechts ist. Kaufrecht nach BGB und HGB ist daher nur dann einschlägig, wenn auf deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts verwiesen wird.
Enthält der Vertrag keine Regelung über das anzuwendende Recht, wird regelmäßig die Rechtsordnung des Landes, in dem der Verkäufer seinen Sitz hat, anzuwenden sein (anders kann es u.a. sein, wenn es zu einem Gerichtsverfahren außerhalb der EU kommt). Ist dieses Land Vertragsstaat des CISG-Übereinkommens, kommt man auch auf diesem Weg zur Anwendung des UN-Kaufrechts. Derzeit gibt es 94 Unterzeichnerstaaten (zur Liste s. hier: https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status). Da, wie oben dargestellt, Deutschland ein Unterzeichnerstaat ist, ist daher bei Fehlen einer Rechtswahlregelung auf Exportgeschäfte das UN-Kaufrecht anzuwenden. Bei Importgeschäften kommt es dagegen darauf an, ob das Land, in dem der Verkäufer seinen Sitz hat, ein Unterzeichnerstaat des Übereinkommens ist.
Ist nach dem vorstehenden UN-Kaufrecht anzuwenden, so gilt Folgendes:
Kann der Lieferant nicht liefern, so haftet er verschuldensunabhängig auf Schadensersatz (Art. 45, 74 ff. CISG). Diese Garantiehaftung ist insofern strenger als die nach deutschem Kaufrecht, weil dort eine Schadensersatzhaftung ein Verschulden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) erfordert. Die Haftung erfasst auch den entgangenen Gewinn des Käufers (Art. 74 CISG).
Allerdings sieht das UN-Kaufrecht in Art. 79 CISG ein einschränkendes Korrektiv vor. Danach haftet der Lieferant nicht, wenn er beweist, dass die Störung außerhalb seines Verantwortungsbereichs lag und unvorhersehbar sowie unvermeidbar war. Hierdurch soll der Verkäufer von der Haftung für unbeherrschbare Risiken entlastet werden. Kriegerische Ereignisse oder Epidemien, die die normale Vertragserfüllung erheblich erschweren, können damit den Händler entlasten. Es kommt aber auf den Einzelfall und die Beweisbarkeit (die ggf. durch ein Force-Majeure-Zertifikat gelingen kann) an. Hat der Verkäufer z.B. den Vertrag mit dem Käufer zu einem Zeitpunkt geschlossen, als sich in der Region, in der der eigene Lieferant sitzt, bereits das die Störung verursachende Ereignis abzeichnete, kann er sich möglicherweise nicht auf Art. 79 CISG berufen und haftet daher dennoch auf Schadensersatz.