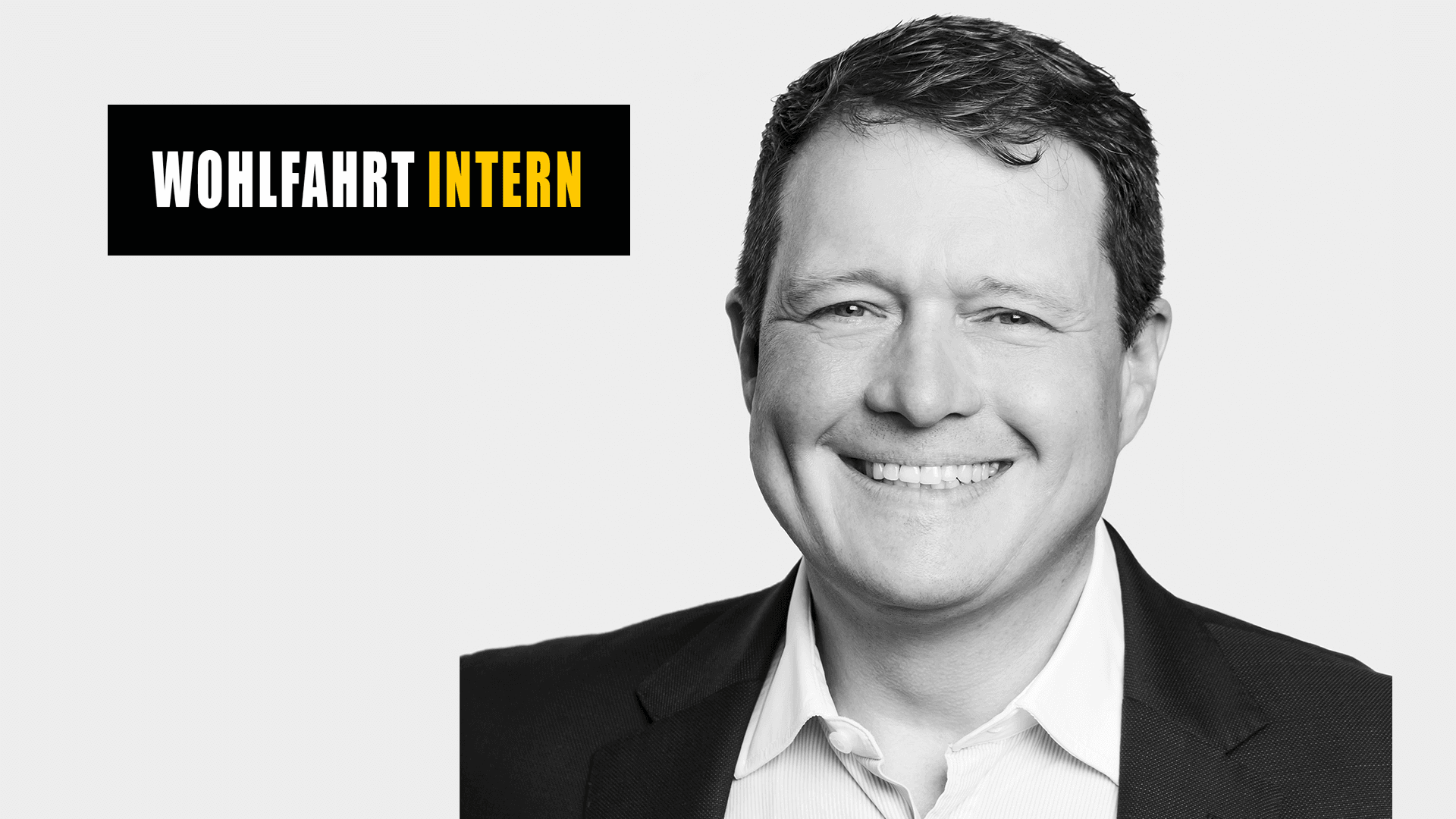Schaffen die geplanten Änderungen im BauGB nachhaltigen Wohnungsbau?
Bei dem Begriff Nachhaltigkeit wird selten hinterfragt, was darunter zu verstehen ist. Hilfreich ist da durchaus auch mal eine simple Google-Recherche und siehe da, die Nachhaltigkeit bezieht sich nicht allein auf den Bereich des Umweltschutzes und der Ressourcensicherung für die Zukunft. Vielmehr gibt es auch eine soziale Nachhaltigkeit, die darauf abzielt, Armut zu vermeiden und menschenwürdige Lebensbedingungen zu schaffen. Seit vielen Jahren liegt der Wohnungsbau brach. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es schätzungsweise 550.000 Wohnungen zu wenig (Studie: Deutschland fehlen rund eine halbe Million Wohnungen). Diejenigen die da sind, sind vor allem in den Ballungsräumen für die Mehrheit der Menschen unbezahlbar geworden. Was kann der Staat hiergegen tun, vor allem der Bund selber mit einer nur eingeschränkten Gesetzgebungskompetenz im öffentlichen Baurecht? Tatsächlich gab es auf Bundesebene vielfältige Initiativen, den Wohnungsmangel zu beheben. Zum einen wurde ein Referentenentwurf zum Gebäudetyp E erstellt, der das Bauen durch den Wegfall vieler so genannter angeblich anerkannter Regeln der Technik verbilligen sollte. Daneben gibt es eine Initiative zur Klärung, was dem einfachen und billigen Bauen rechtlich entgegensteht und jüngst die geplante Änderung des Baugesetzbuches im Juli 2025 unter dem Stichwort des „Bau-Turbos“. Schauen wir uns an, ob die Änderungen tatsächlich eine soziale Nachhaltigkeit herbeiführen können.
Bislang liegt nur ein Gesetzesentwurf zur Änderung des Baugesetzbuches vor, den das Bundeskabinett am 18.06.2025 beschlossen hat (Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung). Es wird damit gerechnet, dass im Herbst 2025 das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen sein wird. Die geplante Änderung verfolgt vier Ziele, nämlich
- den Wohnungsbau zu beschleunigen,
- Lärmschutzfestsetzungen zu erleichtern,
- Umwandlungsschutz verlängern und
- die Bestimmung über Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt zu verlängern.
Der neue § 246e des Baugesetzbuches soll als eine Art Experimentierklausel Abweichungen von Bebauungsplänen zulassen, wenn die Abweichung unter Würdigung nachbarrechtlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. Hierzu soll es eine Anlage 2 geben, die die öffentlichen Belange schärft, u.a. dadurch, dass die Vorhaben keine zusätzlichen erheblichen Umweltauswirkungen verursachen. Die Regelung ist bis zum 31.12.2030 befristet und beansprucht nur Geltung für den Wohnungsbau, die Erweiterung oder Änderung bestehender Wohngebäude und Nutzungsänderungen zu Wohnzwecken. Die Gemeinde muss dem jedoch zustimmen (§ 36a BauGB). Auch der Außenbereich kann einbezogen werden, sofern er in räumlichem Zusammenhang mit Flächen nach den §§ 30 ff BauGB steht (§ 246e Abs. 4). Weiterhin werden die Erfordernisse des Sich-Einfügens in § 34 Abs. 1 BauGB gelockert, was jedoch ebenfalls der Zustimmung der Gemeinde bedarf. Schließlich wird § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB novelliert. Künftig können demnach in begründeten Fällen Abweichungen von den Werten der TA-Lärm zugelassen werden. Schließlich wird die Möglichkeit der Gemeinden, Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt durch Rechtsverordnung festzusetzen, bis zum 31.12.2030 verlängert (§ 250 Abs. 1). Dadurch bleiben Umwandlungen erschwert.
Die Regelungen stehen in dem dürftigen Umfeld dessen, was dem Bund an Gesetzgebungskompetenz im öffentlichen Baurecht zukommt. Sie stehen weiter unter dem Zustimmungserfordernis der Gemeinden, was sich aus dem grundrechtlichen Anspruch der Gemeinden zur Wahrnehmung der Selbstverwaltungsaufgaben aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz ergibt. Dennoch kann erwartet werden, dass sie maßgeblichen Einfluss auf einen Ausbau des Wohnungsmarktes haben. Der Mietwohnungsbau scheiterte bisher nicht allein an der Frage der Rentabilität, die vor allem durch die bisweilen absurden Vorschriften aus den Landesbauordnungen zu Brandschutz, Stellplätzen, Barrierefreiheit etc. hervorgerufen wurde, sondern auch durch einen Mangel an Bauland. Stets war ein Gewerbegebiet zu nah, die Fläche lag schon im Außenbereich, das Vorhaben fügte sich nicht in den unbeplanten Innenbereich ein oder Festsetzungen im Bebauungsplan, insbesondere zur GFZ ließen einen Ausbau nicht zu. Die letztgenannten Hindernisse versucht der Gesetzgeber nunmehr zu entschärfen. Das dürfte auch einen Anreiz an die Landesgesetzgeber bieten, die Landesbauordnungen zu „entrümpeln“.
Investoren sollten sich zunächst auf die Suche nach geeigneten Flächen machen, die den Vorgaben der Gesetzesänderung entsprechen.
Da die Gemeinden jeweils ihre Zustimmung für Wohnungsbauvorhaben erteilen müssen, die sich bislang nicht einfügen, den Festsetzungen im Bebauungsplan nicht entsprechen oder im angrenzenden Außenbereich liegen, dürften die Schwierigkeiten für den Wohnungsbau nur von der Legislativen zur Exekutiven verlagert werden. Eine rechtswidrig verweigerte Zustimmung verweist Investoren – wie schon bisher – auf den langwierigen Rechtsweg mit ungewissem Ausgang, der nahezu jedes Vorhaben uninteressant werden lässt. Weiterhin besteht eine Vielzahl von gesetzlichen Regelungen fort, die den Wohnungsbau erschweren. Gerade im angrenzenden Außenbereich stellen sich in besonderem Maße Fragen nach einer Umweltverträglichkeit (UVPG), dem Vorliegen eines unzulässigen Eingriffs in das Natur- und Landschaftsbild oder dem allgemeinen und besonderen Artenschutz (BNatSchG). Im unbeplanten Innenbereich lässt sich weiter trefflich streiten, ob sich ein Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils einfügt oder nicht. Ob und welche nachbarlichen Interessen berührt sein können, bleibt weiter ebenfalls im gewohnt unberechenbaren Bereich.
Der Gesetzesentwurf kann erst der Anfang der Lösung zu schnellem Bauen bezahlbaren Wohnraums sein. Die Reduzierung wesentlicher Baustandards, die die Bundesregierung ebenfalls anstrebt, liegen überwiegend außerhalb ihres Kompetenzbereichs, nämlich in den Landesbauordnungen. Vom Gebäudetyp E abgesehen, dessen Verwirklichung vor allem durch zivilrechtliche Maßnahmen herbeigeführt werden soll, liegen die größten Hindernisse in überzogenen bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Gebäude und damit in der Gesetzgebungskompetenz der Länder. Neben den Vorgaben aus den Landesbauordnungen und den sie meist ausgestaltenden Musterverwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen (MVV TB) gibt es eine nicht mehr zählbare Anzahl so genannter „allgemein anerkannter Regeln der Technik“, die bislang von den Zivilgerichten als stets geschuldet angesehen werden, ohne dass die Vertragsparteien dies ausdrücklich geregelt haben. Problemtisch daran ist nicht nur, dass diese zum Teil ohne jede wissenschaftliche Basis veröffentlicht werden, sondern auch, dass jedwede Evaluierung auf ihre Sinnhaftigkeit durch staatliche Stellen fehlt. Niemand weiß genau, was zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik alles gehört. Befragt man die betroffenen Verkehrskreise, so kommt in aller Regel der Verweis auf die DIN-Normen, meist auch noch der Verweis auf die VDE-Normen. Unabhängig von der Vielzahl allein dieser DIN- und VDE-Normen können auch bloße Hersteller- oder Verarbeitungsrichtlinien zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik zählen. Und dies, obwohl sie von den Herstellern keineswegs im Sinne einer objektiven Darstellung dessen, was bautechnisch notwendig oder sinnvoll ist, verfasst werden, sondern ausschließlich im Eigeninteresse.
Unternehmen, die bereits Flächen identifiziert haben, die sich nach den Änderungen im BauGB für den Wohnungsbau anbieten, sollten zunächst mit der Gemeinde und der Baugenehmigungsbehörde in Kontakt treten, um zu eruieren, ob und inwieweit diese hierzu gleiche Auffassungen vertreten. Die Klärung dieser bauplanungsrechtlichen Fragen kann in einem Vorbescheidsverfahren erfolgen.
Eine weitere Möglichkeit, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen abzusichern, bestehen in dem Abschluss eines städtebaulichen Vertrags zwischen dem Investor (Vorhabenträger) und der planenden Kommune zur Aufstellung eines so genannten vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Ein solcher Vertrag wird gemeinhin als Durchführungsvertrag bezeichnet und ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag.
Er ist im weitesten Sinne ein gegenseitiger Vertrag. Die Gegenleistung der Kommune besteht jedoch nicht in dem Erlass eines entsprechenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans (§ 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB), sondern nur in der Erfüllung von Mitwirkungspflichten zur Erlangung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Aufstellungsbeschluss, frühzeitige und förmliche Beteiligung, Abwägungsprozess etc.).
Voraussetzung eines solchen Vertrages:
- Hoheit des Vorhabenträgers über die benötigten Grundstücke (§ 12 Abs. 1 BauGB),
- Realisierungsfähigkeit des Vorhabenträgers (§ 12 Abs. 1 BauGB),
- Tragung der Erschließungskosten (§ 12 Abs. 1 BauGB).
Beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan initiiert im Regelfall der Investor das Bauleitplanverfahren. Er stellt der Gemeinde sein Vorhaben vor und regt an, einen Vorhaben- und Erschließungsplan auszuarbeiten, der später Gegenstand des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird.
Fazit und Ausblick
Die Änderungen und Ergänzungen, die der Gesetzesentwurf vorsieht, sind ein erster Schritt auf dem Weg, schnell bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Sie machen den Weg frei für neue Baulandflächen. Der Ansatz der neuen Koalition, das Bauen zu „vereinfachen" und in der Folge auch für die Schaffung preiswerten Wohnraums zu sorgen, muss dabei neben der Absenkung von technischen Baustandards auch die Absenkung rechtlicher Baustandards zum Ziel haben. Ersteres könnte dem Bund über eine Anpassung des Bürgerlichen Rechts gelingen, für das er die konkurrierende Gesetzgebung nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 Grundgesetz innehat. Soll der ganz große Wurf gelingen, dann müsste der Bund sich dazu bekennen, die technischen Standards selbst zu bestimmen. Die kleine Lösung des großen Wurfs könnte darin bestehen, eine Nomenklatur der technischen Regeln zu entwerfen und sie in die Bereiche „sicherheitsrelevant“ und „Komfortmerkmale“ einzuordnen. Die große Lösung würde bedeuten, dass sich der Bund bspw. über seine Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung aufmacht, echte, weil validierte technische Standards zu setzen. Die Reduzierung der rechtlichen Standards aus den Landesbauordnungen kann hingegen nur gelingen, wenn der Bund auch die Länder überzeugt, überzogene Standards aus ihren Landesbauordnungen zu entfernen. Unternehmen der Immobilienwirtschaft sollten daher über ihre Verbände Gesetzesvorschläge erarbeiten lassen, die eine Verschlankung bauordnungsrechtlicher Anforderungen an Wohngebäude zum Inhalt haben.