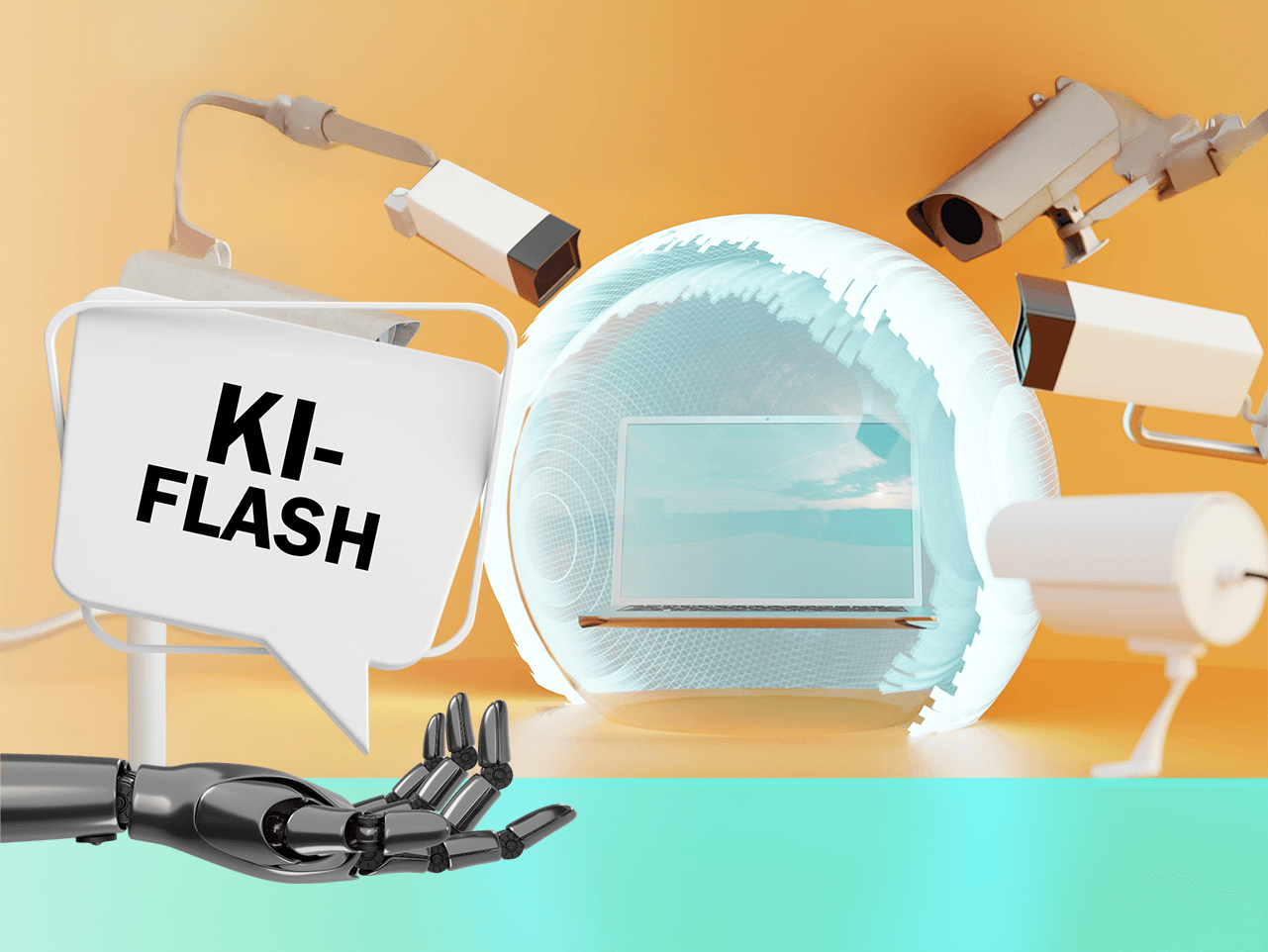Wie weit dürfen Anbieter Künstlicher Intelligenz gehen, wenn es um die Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte geht? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines wegweisenden Rechtsstreits zwischen der GEMA und OpenAI, dem Betreiber des bekannten Chatbots ChatGPT. Mit Urteil vom 11.11.2025 hat das Landgericht München I (Az. 42 O 14139/24) entschieden - zugunsten der GEMA. Dabei hat die Kammer einen neuen rechtlichen Bewertungsmaßstab für das Training und den Output von KI-Modellen angewendet. Das Urteil ist nicht nur ein (Etappen-)Sieg für die Rechteinhaber, sondern könnte auch die Entwicklung und Nutzung von KI-Systemen in Deutschland und Europa nachhaltig beeinflussen.
Worum geht es?
Im Zentrum des Streits zwischen GEMA und OpenAI standen Liedtexte von neun bekannten deutschen Künstlerinnen und Künstlern, darunter Werke von Kristina Bach, Herbert Grönemeyer und Rolf Zuckowski. Die GEMA, die als Verwertungsgesellschaft die Rechte der Urheber wahrnimmt, warf OpenAI vor, diese Texte ohne Zustimmung in ihre Sprachmodelle integriert zu haben. Die Modelle seien auf Basis der geschützten Inhalte trainiert worden und könnten diese auf Nutzeranfrage nahezu wortgetreu wiedergeben.
OpenAI hingegen argumentierte, dass ihre Modelle keine konkreten Daten abspeichern, sondern lediglich Muster und Wahrscheinlichkeiten aus großen Datensätzen erlernen und auf deren Basis Outputs generieren. Zudem berief sich OpenAI auf die Schrankenregelung für Text- und Data-Mining im Urheberrecht (TDM, § 44b UrhG), die die Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke zu Analysezwecken erlaubt.
Die Entscheidung: Verstoß gegen das Vervielfältigungsrecht
Während internationale Verfahren in den USA derzeit meist unter der „Fair Use“-Doktrin geführt werden und britische Gerichte die Zuständigkeit für „ausländisches Training“ oft ablehnen, stellt das LG München I explizit auf den technischen Befund der „Memorisierung“ und Reproduzierbarkeit urheberrechtlich geschützter Werke im Modell ab. Entscheidend sei allein, dass ein Werk (etwa ein Liedtext) im KI-System „wiedererkennbar“ reproduzierbar gespeichert sei – unabhängig davon, wie die Reproduktion technisch zustande komme oder ob sie tatsächlich ausgegeben werde.
Eine solche Speicherung und die Wiedergabe der Texte in Gestalt einer Antwort des Chatbots auf eine Suchanfrage stellen nach Überzeugung des Gerichts eine unzulässige Vervielfältigung der geschützten Werke dar und greifen damit in das Verwertungsrecht der Rechteinhaber ein.
Die „Memorisierung“ sei auch nicht von der Schrankenregelung zum TDM gedeckt, da sie über die reine Analyse von Daten zu Trainingszwecken hinausgehe. Die TDM-Schranke erlaube lediglich die erforderlichen Vervielfältigungen von Werken beim Zusammenstellen eines Datenkorpus für das Training von KI (wie etwa die Vervielfältigung eines Werks durch seine Überführung in ein anderes (digitales) Format oder Speicherungen im Arbeitsspeicher).Im konkreten Fall würden dagegen Werke durch die „Memorisierung“ vervielfältigt, was einen Eingriff in die Verwertungsrechte des Urhebers darstelle. Angesichts der Komplexität und Länge der Liedtexte sei es außerdem ausgeschlossen, dass die Wiedergabe rein zufällig erfolgte. Damit lehnte die Kammer eine innovationsfreundliche, analoge oder erweiterte Anwendung der Schranken klar ab.
Verantwortlichkeit für den KI-generierten Output
Besonders aufschlussreich sind zudem die Ausführungen des Gerichts zur Frage der Verantwortlichkeit für die von den Chatbots generierten Outputs. Nach Auffassung von OpenAI sollte der Nutzer, aber nicht das Unternehmen selbst, für die Erstellung von Outputs (und damit für die Wiedergabe der geschützten Liedtexte) verantwortlich sein, da diese Inhalte lediglich auf den Eingaben (Prompts) des Nutzers basierten. Das Gericht sah dies anders: Als Entwickler und Betreiber der Sprachmodelle trage OpenAI die Verantwortung für die Speicherung der Trainingsdaten, die die generierten Outputs entscheidend prägten. Die Verantwortung liege somit eindeutig bei OpenAI.
Signalwirkung für die KI-Branche
Für Unternehmen wie OpenAI stellt das Urteil eine erhebliche Herausforderung dar. Es stellt klar, dass KI-Anbieter nicht ohne Weiteres kostenlos urheberrechtlich geschützte Inhalte zum Training ihrer Modelle verwenden dürfen. Entscheidend für die Bewertung ist die „Memorisierung“ und Reproduzierbarkeit – und nicht, wie bisher oft diskutiert, nur das Ausgangsmaterial oder der Output.
Daraus ergeben sich weitreichende Folgen für KI-Anbieter und Verwerter. KI-Anbieter werden somit künftig noch genauer prüfen müssen, ob und wie Daten für das Training ihrer Modelle genutzt werden. Zudem geht mit dem gesteigerten Haftungsrisiko von KI-Anbietern eine mögliche Neubewertung der üblichen weitreichenden Haftungsausschlüsse und vertraglichen Freizeichnungsklauseln in AGB gegenüber Anwendern einher.
Im europäischen Raum könnte sich mit dem Urteil eine vom „Fair Use“-Prinzip in den USA abweichende Rechtsauffassung etablieren: Wer KI-Modelle dauerhaft mit geschützten Werken trainiert, muss künftig Lizenzen erwerben – eine Pflicht, die europaweit Schule machen könnte. Zugleich droht eine restriktive Auslegung urheberrechtlicher Vorgaben der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas im Bereich der Entwicklung und Nutzung von KI-Anwendungen entgegenzulaufen und anderen Ländern oder Regionen die Gelegenheit zu geben, selbst durch flexible und privilegierende Regelungen den Rahmen für die transformative Entwicklung und Nutzung von KI-Anwendungen zu setzen.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es ist außerdem davon auszugehen, dass mit dem Urteil nicht das letzte Wort im Rechtsstreit zwischen GEMA und OpenAI gesprochen ist. Es bleibt abzuwarten, wie die nachfolgenden Instanzen in der Sache entscheiden werden.